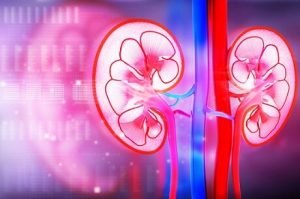Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
eine kurze sequenz aus meiner online-sprechstunde zum thema „übersäuerung & entsäuerung“. die komplette aufzeichnung der online-sprechstunde finden sie hier: video online sprechstunde „die biologische entgiftungstherapie“ mit rené gräber. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
ständig blasenentzündung oder chronische blasenentzündung? bei der blasenentzündung kann sich mehr als nur die blase entzünden: die infektion kann sich auf die oberen harnwege und schließlich in die nieren ausbreiten. die untere harnwegsinfektion ist eine infektion der harnröhre bzw. der blase (auch zystitis genannt und zählt zum breich der urologie ), rund 0,6 % aller blasenentzündungen verlaufen tödlich. kritisch wird es besonders dann, wenn eine infektion des nierenbeckens (zählt zum bereich der nierenkrankheiten ) hinzukommt. vor allem frauen leiden an einer blasenentzündung, da die kurze harnröhre das eindringen von keimen begünstige – so jedenfalls lautet eine gängige begründung der schulmedizin. etwa zehn prozent der frauen bekommen jährlich eine harnwegsinfektion. betroffen sind aber häufig auch ältere männer, wenn eine vergrößerte prostata den harnabfluss erschwert die harnblase kann sich nicht mehr vollständig entleeren, wodurch sich keime stärker vermehren können. erhöht ist das risiko auch nach operationen bei prostatakrebs. eine blasenentzündung beginnt meist mit schneidenden schmerzen bei drangvoller entleerung kleiner harnmengen, in denen große mengen bakterien und manchmal auch blut gefunden werden können. bei schweren entzündungen kommen fieber , nachtschweiß und schüttelfrost dazu sowie ein starkes „krankheitsgefühl“. übelkeit mit erbrechen sind warnzeichen einer verschlimmerung. wenn ein patient einen verwirrten eindruck macht, sind wahrscheinlich schon die nieren betroffen. neben den symptomen kann eine medizinischen untersuchung mit mikrobiologischen tests die diagnose sichern. in den meisten fällen ist das darmbakterium escherichia coli der auslöser, aber auch andere erreger wie streptokokken, staphylokokken und andere mikrobionten kommen infrage. nicht selten handelt es sich um zoonosen, bei denen bakterien von tieren auf den menschen überspringen. in us-kliniken haben forscher coli-stämme gefunden, die eindeutig vögeln, insbesondere mastgeflügel, zuzuordnen sind. ursache: resistente keime, parasiten, pilze. bakterien, die resistent gegen antibiotika sind, kommen nicht nur gehäuft in krankenhäusern vor, sondern auch auf fleisch aus der massentierhaltung. jeder kann selber auf gesunde ernährung achten und kann so etwas vorbeugend gegen blasentzündungen tun. einige stämme von coli-bakterien haben strategien entwickelt, die blaseninnenwand optimal zu besiedeln. sie bilden einen biofilm („zell-rasen“), der sie vor antibiotika schützt sowie ausstülpungen an der zelloberfläche, mit denen sie sich an die blaseninnenwand regelrecht festkleben können. besonders in ärmeren ländern mit mangelnder hygiene verursachen parasiten wie madenwürmer und manche egel ebenfalls blasenentzündungen. beteiligt sein kann auch der hautpilz candida. was kann man bei blasenentzündung tun? die schulmedizin begegnet einer blasenentzündung mit antibiotika. zur vorbeugung empfehlen viele ärzte eine impfung, besonders wenn eine chronifizierung oder ständige neu-infektionen drohen. empfohlen wird manchmal auch methylenblau. das ist die vorstufe von hydroxychloroquin, das die bakterien oxidativ schädigt. eine ordentliche zulassung für diese anwendung hat methylenblau allerdings nicht. bei den kleinsten anzeichen einer aufkommenden blasenentzündung können etliche sofortmaßnahmen helfen:. 5 mal tägl. eine tasse „dr. mausers nieren- und blasentee“ nach anweisung. jeder tasse gibt man einen tl „cystinol“ und einen tl „biosanum essenz“ bei (aus der apotheke). außerdem nimmt man „pyelitis-tropfen“ nach folgendem schema: 1 woche lang 5 mal tägl. 30 tropfen 1 woche lang 4 mal tägl. 30 tropfen 6 wochen lang 3 mal tägl. 30 tropfen. äußerlich helfen umschläge mit „biosanum-essenz“. auf eine tasse abgekochtes wasser gibt man einen el essenz, tränkt einen größeren leinenlappen damit und legt ihn bis zu 4 stunden tägl. über der blasengegend auf. trinken ist wichtig! senken sie den ph-wert des urin indem sie saure dinge trinken: ich empfehle vitamin c pulver. eine messerspitze auf ein kleines glas wasser, mehrmals täglich trinken. dieses vorgehen ist auch für eine chronische blasenentzündung geeignet. wichtig ist strenge bettruhe. während und nach der erkrankung unbedingt warm halten. aus der „volksmedizin“ bei einer blasenentzündung. zwiebel-wickel wurden schon von den alten ägyptern bei entzündlichen erkrankungen wie bronchitis , mittelohrentzündung oder blasenentzündung angewandt:. schneiden sie frische zwiebeln in dünne ringe und packen sie diese zwischen zwei lagen verbandmull. hängen sie dann das kleine paket über ein wasserbad und bringen sie das wasser zum kochen. dabei kontakt zwischen wasser und wickel unbedingt vermeiden. erhitztes säckchen auf entzündete stelle legen und mit weiterem verbandmull fixieren. anschließend mit wolltuch zudecken. erst abnehmen, wenn die zwiebeln kalt sind. wer zu blasenentzündungen neigt, kann mit cranberries vorbeugen. die früchte enthalten wirksame proanthocyanidine. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:. beitragsbild: 123rf.com – thamkc. dieser beitrag wurde letztmalig am 28.01.2024 bearbeitet.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
harnwegsinfekt: ursachen, verlauf, diagnose therapie. ein harnwegsinfekt (hwi) ist eine entzündliche erkrankungen der ableitenden harnwege. als hauptverursacher gelten in der schulmedizin verschiedene bakterien. daneben werden aber auch einige pilze (z.b. candida albicans), protozoen und viren für die entzündungen verantwortlich gemacht. in sehr seltenen entstehen die entzündlichen prozesse auch im rahmen medizinischer therapien, z.b. die durch strahlentherapie verursachte strahlenzystitis. bedingt durch anatomische unterschiede bei mann und frau zeigt sich ein harnwegsinfekt wesentlich häufiger bei frauen. ihre harnröhre ist deutlich kürzer und bietet so den bakterien einen schnelleren zugang. nahezu jede fünfte frau hat in ihrem leben mindestens einmal einen harnwegsinfekt durchlebt, ca. ein drittel der betroffenen klagt über rezidivierende entzündungen. ebenfalls vermehrt leiden ältere männer an einer entzündung. hier liegt meist eine vergrößerte prostata (vorsteherdrüse) vor, die den harnfluss behindert. abb.1: eine grafische darstellung der nieren zusammen mit den großen blutgefäßen und den ableitenden harnwegen. bild: 123rf, rajesh rajendran nair. die ableitenden harnwege bestehen aus den harnleitern (führen den urin vom nierenbecken zur blase), der harnblase (sammelstelle des urins) und der harnröhre (führt den urin nach außen). je nach entzündetem bereich lassen sich harnwegsinfekte in obere und untere infektionen unterteilen. bei oberen infekten sind das nierenbecken (pyelonephritis) und der harnleiter betroffen. bei unteren entzündungen kommt es zu zystitis (entzündung der blase) und urethritis (entzündung der harnröhre), beim mann kann zusätzlich noch die prostatitis (entzündung der prostata) hinzugezählt werden. als hauptverursacher akuter harnwegsinfektionen gelten in der schulmedizin bakterien, die aus dem magen-darm-trakt stammen sollen. zu über 80 prozent lässt sich hier das bakterium escherichia coli entdecken, welches durch verschiedene umstände in den harntrakt gelangen soll. vorrangig können bestimmte sexualpraktiken (analer geschlechtsverkehr) genannt werden, die sowohl bei männern als auch frauen die entzündungen hervorrufen können. eine so entstandene zystitis wird umgangssprachlich auch als „honeymoon zystitis“ bezeichnet. daneben kommen bei der frau auch der geburtsvorgang oder ein östrogenmangel nach den wechseljahren als begünstigende faktoren für ein bakterienwachstum in frage. weitere begünstigende faktoren für harnwegsinfekte sind der längere aufenthalt in großer kälte ohne ausreichenden schutz vor durchfeuchtung, stoffwechselerkrankungen (z.b. diabetes mellitus , gicht ), manipulationen der harnwege von außen (z.b. katheterisierung), abflussstörungen (durch harnsteine, tumoren ), schwangerschaft, falsches hygieneverhalten (vor allem bei frauen, hier befinden sich harnröhre, scheide und after in unmittelbarer nachbarschaft), abwehrschwäche und ein hohes lebensalter. harnwegsinfektionen treten akut auf und weisen durch die verschiedenen abschnitte für den urintransport eine reihe unterschiedlicher symptome auf. treten diese anzeichen innerhalb eines jahres wiederkehrend (mindestens drei mal) ein, spricht der mediziner von rezidivierenden infekten. die akute blasenentzündung zeichnet sich vor allem durch dysurie (erschwerte blasenentleerung) und pollakisurie (andauernder harndrang bei gleichzeitig nur fraktionierter entleerung) aus. zusätzlich ist das wasserlassen schmerzhaft (algurie), vor allem in der nacht, wo ebenfalls ein vermehrter harndrang besteht (nykturie). es kommt zu blasenkrämpfen (tenesmen) und in seltenen fällen auch zu erhöhter körpertemperatur. durch den andauernden reiz kann der urin blutbestandteile (hämaturie ) oder auch eiter (pyurie) aufweisen. lesen sie auch den beitrag zu: blasenschmerzen. die nierenbeckenentzündung kann sich als folge einer zystitis entwickeln (bei bis zu 30 prozent). hierbei wandern die bakterien weiter aufwärts und führen beim betroffenen zu einem starken krankheitsgefühl mit hohem fieber und schüttelfrost sowie zu starken schmerzen vom unterbauch bis zum schambein sowie flankenbereich hin. kinder mit akuter pyelonephritis weisen zudem bauchschmerzen , übelkeit , erbrechen und verwirrtheitszustände auf. die entzündete harnröhre (urethritis) führt meist nur zu brennen und jucken während des wasserlassens, in seltenen fällen findet sich bei der ausscheidung auch eiter im urin. das reiter-syndrom kennzeichnet eine kombination von gleichzeitiger urethritis, arthritis (gelenkentzündung ) sowie uveitis (bindehautentzündung) bei der frau, deren genese noch nicht geklärt ist. die bakteriell verursachte prostatitis beim mann führt zu starken schmerzen im unterbauch, peritonitis (bauchfellentzündung), hohem fieber und allgemeiner leistungsschwäche. die anamnese gibt häufig bereits erste hinweise auf einen harnwegsinfekt. für die gesicherte diagnose werden das blutbild , sammelurin und mittelstrahlurin (urinuntersuchungen ) ausgewertet. nieren und harnblase können mittels ultraschall dargestellt werden, die zystoskopie (blasenspiegelung) dient dem ausschluss von tumoren und einengungen. zusätzlich können röntgendarstellungen aufschluss über weitere erkrankungen bringen. je nach vorliegendem befund werden vor allem medikamentöse therapien (antibiotika, schmerzmittel, spasmolytika) angewandt. bei verlegung durch einen harnstein oder tumor muss diese ursache primär behandelt werden. zusätzlich unterstützen allgemeine maßnahmen wie ausreichende flüssigkeitszufuhr, sorgfältige hygiene, regelmäßige blasenentleerungen ohne zeitdruck und schonung (z.b. bettruhe) die rasche ausheilung (innerhalb einer bis zwei wochen). bei unzureichender oder falscher therapie können sich die erreger auch über den blutweg weiter ausbreiten. die hierdurch entstehende blutvergiftung (urosepsis) hat lebensbedrohliche folgen (septischer schock) für den betroffenen. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:. beitragsbild: 123rf.com – ralwel. dieser beitrag wurde letztmalig am 19.07.2012 aktualisiert.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
blasenkrebs: symptome, anzeichen, therapie und heilungschancen. das harnblasenkarzinom ist ein bösartiger krebs der schleimhaut, der sich vermehrt im hohen alter entwickelt (gipfel um das 70. lebensjahr) und als vierthäufigste tumorerkrankung bei männern gilt (männer erkranken ca. vier mal so oft wie frauen). die inzidenz liegt bei ca. 18 pro 100.000 menschen, dabei ist ein gehäuftes vorkommen in industrienationen zu beobachten. das karzinom entwickelt sich meist am blasenboden in der nähe der harnröhre. die entstehung ist noch nicht vollständig ergründet. wesentliche faktoren, die eine entstehung begünstigen, sind v.a. chronische entzündungen der harnblase (auch die bilharziose in tropenländern, eine durch einzeller im wasser verursachte harnblasenentzündung), nikotinkonsum (erhöht das risiko um das dreifache), chemische substanzen (besonders bei arbeiten in fabriken mit chemikalien, gummi, ölen, eisen und farben), schmerzmittelmissbrauch, spezielle zytostatika und arsen. die symptomatik von blasenkrebs ist nicht spezifisch. blut im urin gilt als frühsymptom, dieses zeigt sich aber auch bei vielen anderen erkrankungen im bereich von nieren (nierenkrankheiten ) und harnblase. im fortgeschrittenen stadium kann die blutmenge zunehmen, auch kommt es hier vermehrt zu schmerzen im unterbauch oder beim wasserlassen. z.t. erfolgt der urinablass fraktioniert, in kleinen mengen, dies führt zu einem stetigen harndrang. betroffene leiden unter flankenschmerzen, die bis in den rücken (rückenschmerzen ) ausstrahlen können. hinzu kommen allgemeine symptome wie z.b. fieber , abgeschlagenheit, leistungsschwäche, müdigkeit und stauungszeichen an den beinen. in der diagnostik werden neben anamnese und inspektion urintests genutzt (blutbeimengungen , urinmenge, aussehen). zur differenzierung erfolgt die zystoskopie (harnblasenspiegelung), z.t. mit entnahme einer gewebeprobe. zusätzlich können urographie (röntgen-kontrast-aufnahme der harnwege), ct und mrt genutzt werden. die szintigraphie wird bei verdacht von knochenmetastasen angewandt. zur therapieerstellung wird der tumor nach der tnm-klassifikation (tumor-knoten/nodus-metastase) eingeteilt. nahezu 80 prozent aller betroffenen weisen ein geschwür auf, das (lokal begrenzt) oberflächlich in der blase liegt und noch nicht bis zur muskulatur vorgedrungen ist. hier kann das karzinom mit dem zystoskop entfernt werden (transurethrale resektion – tur). zur vermeidung eines rezidivs wird zusätzlich ein chemotherapeutikum verabreicht, welches über einen zeitraum von sechs bis acht wochen in die blase eingeträufelt wird (= instillationstherapie). ist der blasenkrebs weiter eingewachsen, wird die blase vollständig entfernt (radikale zystektomie). bei männern erfolgt zusätzlich eine exzision von prostata und samenblase, bei frauen von gebärmutter, eierstöcken und einem teil der scheidenwand. ist die harnröhre betroffen, wird auch diese entfernt. nach entfernung der blase wird entweder ein künstlicher ausgang zur bauchdecke (ähnlich einem darmausgang) gelegt (v.a. als ileum conduit) oder aber mithilfe eines stillgelegten darmabschnitts eine neue blase (neoblase) gebildet, die an die harnröhre angeschlossen wird und die über aktives pressen der betroffenen entleert werden kann. bei schlechter prognose (z.b. wenn alle bereiche operativ entfernt werden mussten) werden die harnleiter in den letzten teil des dickdarms gelegt (ureterosigmoidostomie), die ausscheidung erfolgt somit kombiniert mit dem stuhl. durch die vermehrte flüssigkeit führt dies häufig zu unangenehmen durchfällen. kann die blase nicht entfernt werden (z.b. zu weit fortgeschrittenes wachstum) erfolgt eine kombinierte strahlen- und chemotherapie , die z.t. das wachstum eindämmt und gleichzeitig auch beschwerden lindert. je früher blasenkrebs diagnostiziert wird, umso bessere heilungschancen bestehen. über ein zystoskop entfernte geschwüre weisen eine hohe rezidivrate auf, die durch chemotherapie eingedämmt werden kann. über 80 prozent der betroffenen können auch nach vollständiger blasenentfernung ein relativ normales leben führen. die prognosen sinken jedoch mit befall von lymphknoten. metastasen in anderen organen (z.b. lunge) führen meist rasch zu einem letalen ausgang. weitere artikel zum lesen: blasensenkung. übrigens: wenn sie so etwas interessiert, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen newsletter „hoffnung bei krebs“ dazu an:. beitragsbild: pixabay.com – pdpics. dieser beitrag wurde letztmalig am 19.07.2012 aktualisiert.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
reizblase: symptome, verlauf, therapie. die reizblase (urge-blase) ist eine recht unbekannte erkrankung, aber mit einer sehr hohen prävalenz. diese diskrepanz kommt daher zu stande, dass sich viele der betroffenen für ihr leiden schämen und daher nicht darüber sprechen. es ist fast ausschließlich das weibliche geschlecht betroffen. bei den über 40 jährigen frauen leiden weit mehr als zehn prozent unter einer reizblase. bei männern tritt dieses leiden nur in ausnahmefällen auf und sollte noch uneingeschränkter anlass zu einer gründlichen diagnostik geben als beim weiblichen geschlecht. ursachen die zu einer reizblase führen. die ursache ist noch völlig unklar, prinzipiell wird eine motorische (mit nachweisbarer hyperaktivität des blasenmuskels) von einer sensorischen (mit früh einsetzendem harndrang) reizblase unterschieden. eine organische ursache konnte bis jetzt nicht gefunden werden. vermutlich kommt es zu einem gestörten gleichgewicht zwischen beckenboden- und blasenmuskulatur. diese könnte durch eine störung im vegetativen nervensystem entstehen. in einigen fällen konnte zusätzlich ein hormonmangel nachgewiesen werden, dessen bedeutung ist allerdings noch nicht ganz geklärt. einige mediziner schuldigen einen „falsch trainierten“ blasenmuskel an, welcher zu der blasen-beckenboden-dysbalance führt. ursächlich soll dabei ein häufiges bewusstes wasserlassen bei noch unvollständig gefüllter blase sein. der blasenmuskel „merkt“ sich dieses vorgehen und im laufe der zeit lässt sich das häufige wasserlassen kaum noch unterdrücken. eine andere these geht von einer chronischen okkulten (also nicht sichtbaren) infektion aus, welche den blasenmuskel dauerhaft reizt. da bei der reizblase keine organische ursache direkt sichtbar ist, werden auch psychische faktoren, ähnlich wie bei dem reizdarm , diskutiert. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen praxis-newsletter mit den „5 wundermitteln“ an:. kleine anmerkung: die sache mit den „5 wundermitteln“ ist mit abstand der beliebteste newsletter, den meine patienten gerne lesen…. symptome. typische symptome sind ein starker harndrang (auch wenn die blase nur leicht gefüllt ist) und ein übernormal häufiges wasserlassen. die urinmenge über den gesamten tag ist aber nicht erhöht und entspricht der eines gesunden. der harndrang kann so stark sein, dass der betroffene nicht schnell genug die toilette erreicht und der urin nicht mehr gehalten werden kann, es kommt zu der so genannten drang- oder urge-inkontinenz. in einigen fällen kommt es zu einem dumpfen schmerz über der blase oder im gesamten unterleib. auch schmerzen beim geschlechtsverkehr können auftreten. in der zusammenschau wird deutlich, dass eine reizblase zu einer massiven einschränkung der lebensqualität führen kann und dann nicht selten psychische und soziale folgen auftreten. diagnose. die diagnostik umfasst eine gründliche urologische und gynäkologische untersuchung, um eine organische ursache sicher ausschließen zu können. differentialdiagnostisch muss z.b. an die häufigste infektion der erwachsenen frau gedacht werden, dem harnwegsinfekt. dieser zeigt sich ganz ähnlich, nämlich mit starkem harndrang und gehäuftem wasserlassen. typischerweise kommen jedoch noch schmerzen oder brennen beim wasserlassen, blasenkrämpfe und ggf. fieber hinzu. daher gehört zu einer basisdiagnostik auch eine urinuntersuchung auf hinweise für einen harnwegsinfekt. im urin finden sich dann weiße blutkörperchen , bakterien, nitrit als bakterielles stoffwechselprodukt und ggf. blut im urin oder eiweiß. auch können bösartige tumore die blasenwand reizen, selbst schon die schwer zu diagnostizierbaren vorstufen (carcinoma in situ), welche noch nicht in das blaseninnere eingewachsen sind. gutartige blasentumore können ähnliche beschwerden machen, sind aber insgesamt sehr selten. bei großen malignen tumoren sind im urin bösartige zellen und blut nachzuweisen. das blut im urin ist oft schon mit dem bloßen auge sichtbar (makrohämaturie), schmerzen bestehen in der regel nicht. jede schmerzlose makrohämaturie sollte durch einen urologen im hinblick auf einen tumor abgeklärt werden. frühe tumorstadien lassen sich oft nur durch eine blasenspiegelung ausschließen. dabei werden aus mehreren quadranten proben entnommen und unter dem mikroskop untersucht. die therapie erfolgt primär chirurgisch, ergänzend sind chemo-therapie und bestrahlung möglich. gynäkologisch sollte bei frauen im gebärfähigen alter eine schwangerschaft ausgeschlossen werden. in der frühschwangerschaft drückt die wachsende gebärmutter bei ihrem weg aus dem kleinen becken heraus auf die blase und kann ganz ähnliche symptome verursachen. bei älteren frauen kann aber auch eine gebärmuttersenkung auf grund einer beckenbodenschwäche eine reizblase imitieren. besonders betroffen sind frauen, welche viele kinder geboren haben. die gebärmutter wird in diesem fall nicht mehr ausreichend von dem beckenboden getragen und sinkt dann zwischen darm und blase. durch den druck reizt sie somit mechanisch die harnblase und führt zu ständigem harndrang, nicht selten mit gleichzeitiger inkontinenz beim z.b. husten , niesen oder lachen (belastungs-inkontinenz). oft kommt es durch den äußeren druck auf den darm gleichzeitig zu einer verstopfung , da die darmlichtung zusammengedrückt wird wird. die diagnose kann durch einen gynäkologen oder urologen gestellt werden. therapeutisch steht gezieltes beckenbodentraining im vordergrund. reicht dieses nicht aus, ist die therapie chirurgisch (z.b. beckenbodenstraffung, transvaginales tape). auch kann eine unter der blase liegende verengung (infravesikale obstruktion z.b. durch narbenstränge, tumore oder beim mann durch eine vergrößerte prostata ) ursächlich sein. diese können (durch den harnstau mit daraus resultierender blasendehnung) zu einem starken harndrang und bei weiterem fortbestehen zu einer so genannten überlaufinkontinenz führen. gegenteilig kann aber auch ein unzureichender blasenverschluss zu häufigen toilettengängen und inkontinenz führen. beides kann durch einen urologen ausgeschlossen werden. seltene ursachen sind neurogene (durch die nerven bedingte), myogene (durch die muskeln bedingte), vaskuläre (durch die zuführenden blutgefäße bedingte) oder hormonelle störungen. auch ein zustand nach einer bestrahlung (radiogener schaden) kann zu dem bild einer reizblase führen. ebenfalls sollte an reizende fremdkörper oder die seltene interstitielle zystitis (blasenentzündung innerhalb der blasenwand) gedacht werden. lesen sie auch den beitrag zu: blasenschmerzen. therapie. die therapie erfolgt antibiotisch, zusätzlich unterstützt eine hohe trinkmenge und wärme den heilungsprozess. ziel der therapie einer reizblase ist es, den harndrang medikamen-tös abzuschwächen. bevorzugt werden so genannte anticholinerge substanzen eingesetzt. diese erhöhen den auslasswiderstand und erreichen somit eine verminderte anzahl an toilettengängen und eine erhöhung der blasenfüllungsvolumina. zu bedenken sind allerdings teilweise sehr beeinträchtigende nebenwirkungen, welche die dosis nach oben begrenzen. zusätzlich können calciumantargonisten und alpha-1-rezeptor-blockierende medikamente eingesetzt werden. dieser ansatz ist jedoch bei der sensorischen reizblase oft nicht so effektiv wie bei der motorischen variante. daher werden bei der sensorischen form zusätzlich trizyklische antidepressiva empfohlen. besserung verschaffen ebenfalls lidocain-instellationen direkt in die blase. liegt vermutlich ein hormonmangel (vor allem von östrogenen) zu grunde, sollte dieses substituiert werden. bei einem geschwächten beckenboden können die patientinnen auch von einer elektrostimulation und einer sakralen neurostimulation zur aktivierung des beckenbodens profitieren. in einigen fällen greift keine therapie und die psychische beeinträchtigung ist so stark, dass die blase komplett entfernt werden muss. unbedingt sinnvoll ist eine begleitende psychische und psychosomatische therapie. für die diagnostik und therapie essentiell ist, dass es sich bei der reizblase um eine ausschlussdiagnose handelt. diese darf also nur nach gründlicher und vollständiger diagnostik gestellt werden. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:. beitragsbild: pixabay.com – alexas_fotos. dieser beitrag wurde letztmalig am 06.08.2013 aktualisiert.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
blasensenkung: symptome, verlauf, therapie. die menschliche harnblase (vesica urinaria, cystis) ist ein dehnbares hohlorgan, welches der speicherung des urins dient. sie ist im kleinen becken gelegen und zum teil von peritoneum (bauchfell) überzogen. am blasengrund liegt die urethra (harnröhre), welche durch das sogenannte blasenzäpfchen zur harnblase hin abgedichtet ist. zusammen mit weiteren strukturen dient dies der kontinenz. ursachen die zu einer blasensenkung führen. die harnblase wird durch mehrere anatomische strukturen beweglich in ihrer position gehalten. hierzu zählen der beckenboden mit seinem bandapparat, verschiedene muskel-band-stränge und bindegewebige anteile. der harnblase dicht angelagert ist das rektum (mastdarm). bei der frau liegen zusätzlich die gebärmutter (uterus), die ovarien (eierstöcke) und die vagina im kleinen becken, beim mann ist es die prostata. zudem finden sich in unmittelbarer nachbarschaft die symphyse (knöcherne verbindung zur bildung der schambeinfuge) sowie der musculus levator ani (afterhebermuskel). die blasensenkung (descensus vesicae) ist eine verlagerung der blase nach unten (richtung beckenboden) und hinten hin. da die männliche harnblase zusätzlichen durch die prostata gestützt wird, kommt es nahezu ausschließlich bei der frau zu dieser störung. die blasensenkung tritt vor allem im fortgeschrittenen lebensalter (ab den wechseljahren ) auf und geht meist einher mit einer veränderten beckenbodenmuskulatur. daneben können auch hormonelle faktoren eine wesentliche rolle spielen. verglichen mit der männlichen beckenbodenmuskulatur ist die weibliche wesentlich instabiler. die muskulatur muss eine gewisse dehnbarkeit besitzen, um z.b. den geburtskanal der vagina ausreichend öffnen zu können. dies erklärt auch, warum vermehrt frauen nach einer geburt unter einer blasensenkung leiden. folgen mehrere geburten rasch aufeinander, hat der muskel-band-apparat keine ausreichende zeit zur verfügung, um seine alte stabilität wiederzuerlangen. zusätzlich zur überdehnung können auch verletzungen im unteren beckenbodenbereich auftreten, z.b. bei sehr großen neugeborenen oder einer „zangengeburt“. eine blasensenkung begünstigende faktoren sind u.a. übergewicht , häufiges heben schwerer gegenstände, permanente körperliche belastung, chronisches husten (z.b. bei lungenerkrankungen ), vormalige operationen im beckenbereich oder andauernde verstopfungen. auch eine angeborene bindegewebsschwäche muss in betracht gezogen werden. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen praxis-newsletter mit den „5 wundermitteln“ an:. kleine anmerkung: die sache mit den „5 wundermitteln“ ist mit abstand der beliebteste newsletter, den meine patienten gerne lesen…. in vielen fällen liegt eine kombination aus überlastung der beckenbodenmuskulatur sowie hormonell bedingten veränderungen von muskulatur und bindegewebe vor. mit erreichen der wechseljahre verändert sich der hormonhaushalt der frau. durch einen verminderten östrogenspiegel bildet sich die genitale schleimhaut zurück, was die elastizität von muskulatur und bindegewebe beeinflusst. nicht immer wird ein descensus vesicae von der betroffenen frau bemerkt. leichte senkungen z.b. sind meist symptomlos. zudem ist das empfindungsspektrum jeder frau verschieden. zu beschwerden kommt es immer dann, wenn die senkung störungen verursacht. betroffene frauen fühlen einen druck im unteren beckenbereich, bedingt durch die unmittelbare nachbarschaft vor allem in der vagina. es ist das gefühl eines „störfaktors“ oder man glaubt, dass in nächster zeit etwas aus der scheide fallen würde. der druck kann im verlauf zunehmen und zu starken schmerzen führen. auch das sexualverhalten kann hierunter leiden, da sich die beschwerden bei manipulation im scheidenkanal (z.b. durch geschlechtsverkehr) häufig verstärken. durch das absenken der harnblase wird vielfach auch der harnleiter verlegt. dies äußert sich durch ein gestörtes miktionsverhalten, bei dem nach jedem wasserlassen noch restharn in der blase verbleibt und zu einem vermehrten harndrang führt. im verlauf drohen harninkontinenz (stressinkontinenz durch schädigung der versorgenden nerven sowie vernarbung des gewebes) sowie auch in einigen fällen, durch die unmittelbare nachbarschaft zum enddarm, die obstipation (verstopfung). weitere symptome, die auf einen descensus hindeuten können, sind blutiger ausfluss aus der scheide sowie infektionen von harnblase, gebärmutter oder vagina. ohne geeignete therapie kann es dazu kommen, dass die harnblase vollständig absinkt und den harnleiter abklemmt. es droht ein lebensgefährlicher harnverhalt. und auch das absenken der benachbarten organe bis hin zum totalen vorfall (genitalprolaps), bei dem u.a. die gebärmutter aus der scheide austritt, ist möglich. ein descensus vesicae ist durch äußerliche inspektion meist nicht erkennbar, weshalb der behandelnde arzt ein detailliertes bild der aufgetretenen beschwerden benötigt. zur anamnese gehören dabei u.a. auch die täglichen tätigkeiten, das miktionsverhalten (wie häufig und wie viel urin pro tag) sowie vorangegangene geburten, denn alle informationen zusammen können erste anhaltspunkte für die vorliegende störung liefern. im verlauf der untersuchungen erfolgen eine uroflowmetrie (harnstrahlmessung), die sonographie von blase, nieren und angrenzenden organen, die zystoskopie (blasenspiegelung) sowie die palpation (abtasten) der anatomischen strukturen. bei zusätzlichen darmentleerungsstörungen sollte dies proktologisch abgeklärt werden (z.b. mittels rektoskopie = spiegelung). therapie. der behandlung einer blasensenkung stehen verschiedene therapiemöglichkeiten zur verfügung. leichte formen eines descensus können durch beckenbodengymnastik deutlich gemildert werden. mithilfe von reizströmen wird die beckenbodenmuskulatur ebenfalls aktiviert und zur stärkung angeregt. bei übergewicht erfolgt z.b. die gezielte umstellung der ernährung, die auch der regelmäßigen stuhlentleerung dienlich sein kann. der hormonhaushalt kann verändert werden, u.a. mittels östrogenisierung der vagina. durch einlage eines pessars wird die blase gegenüber dem beckenboden abgestützt. das pessar kann verschiedene formen besitzen und ist in der regele aus hygienischem kunststoff. es wird über die scheide eingeführt (meist durch die betroffenen frauen selbst) und kann indirekt auch zu einer stärkung der beckenbodenmuskulatur beitragen. droht ein prolaps oder sind die angewandten maßnahmen nicht ausreichend, erfolgt der operative eingriff, bei dem ein netz zur stützung des beckenbodens eingelegt wird (sakrokolpopexie). diese operation kann über die geöffnete bauchwand oder auch laparoskopisch (minimalinvasiv) durchgeführt werden. eine blasensenkung lässt sich nicht immer verhindern, es bestehen jedoch geeignete maßnahmen zur prophylaxe. generell sind andauernde belastung und regelmäßiges heben schwerer gegenstände zu vermeiden. vor allem schwangere frauen sollten sich schonen, sowohl vor der geburt als auch noch einige wochen nach der geburt (um u.a. dem muskulatur-band-apparat zeit zur regeneration zu geben). die beckenbodenmuskulatur lässt sich durch gezielte übungen (z.b. regelmäßiges an- und entspannen) stärken. und auch eine gesunde lebensweise mit physiologischem körpergewicht, leicht verdaulichen mahlzeiten, ausreichender flüssigkeitszufuhr sowie dem verzicht auf noxen (z.b. nikotin) können eine deutlich prophylaktische wirkung besitzen. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:. beitragsbild: 123rf.com – steklo. dieser beitrag wurde letztmalig am 21.04.2015 aktualisiert.
Drücken Sie „Play“, um diesen Inhalt anzuhören
blasenentzündung erkennen und behandeln: die besten tipps für schnelle linderung. lage und aufgabe der blase. bei der frau befindet sich die blase schräg vorne unter der gebärmutter, beim mann liegt sie vor dem enddarm (rectum) und über der prostata. nach oben hin ist die blase vom übrigen bauchraum durch das bauchfell getrennt. die blase ist ein sogenanntes hohlorgan. sie ist ein sack aus muskelgewebe, der je nach füllung größer oder kleiner ist. eine aufgabe der blase ist es, den harn zu speichern. dieser wird in den nieren produziert und über die beiden harnleiter (ureter) in die blase transportiert. eine weitere aufgabe besteht darin, den urin auszuscheiden. dazu ziehen sich die muskeln der blasenwand zusammen und befördern den harn über die harnröhre aus dem körper. blasenentzündung (zystitis ). die zystitis ist eine der häufigsten blasenerkrankungen. die entzündung wird meist durch bakterien ausgelöst, die durch die harnröhre in die blase gelangen. frauen sind von einer akuten zystitis weit öfter betroffen als männer. der grund dafür liegt in der anatomie der frau. die harnröhre im weiblichen körper ist sehr viel kürzer als im männlichen und so haben bakterien einen kürzeren weg in die blase. außerdem ist der ausgang der harnröhre näher am after gelegen, wodurch die dort vorkommenden bakterien leicht in die harnröhre gelangen können. bakterien in der blase führen zu einer entzündung der schleimhaut. der betroffene leidet unter ziehenden unterleibsschmerzen und häufigem harndrang. dabei ist jeder toilettengang mit schmerzhaftem brennen verbunden und obwohl der patient das gefühl einer vollen blase hat, scheidet er nur ein paar tropfen urin aus. manchmal findet man ein wenig blut im urin. der arzt stellt die diagnose zystitis mit hilfe der genannten symptome und mit einer labortechnischen urinuntersuchung. häufig wird ein antibiotikum verschrieben, vor allem wenn die blasenentzündung chronisch auftritt. bei schwächeren entzündungen können auch pflanzliche mittel helfen. die heilung wird unterstützt durch warmhalten des beckens und vor allem durch häufiges trinken. durch eine erhöhte flüssigkeitsaufnahme werden die harnwege gut gespült und bakterien nach außen geleitet. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen praxis-newsletter mit den „5 wundermitteln“ an:. kleine anmerkung: die sache mit den „5 wundermitteln“ ist mit abstand der beliebteste newsletter, den meine patienten gerne lesen…. inkontinenz. kann das ausscheiden des urins nicht willentlich zurückgehalten und kontrolliert werden, so spricht man von harninkontinenz. diese funktionsstörung wird durch unterschiedliche ursachen hervorgerufen und tritt in verschiedenen formen auf. es gibt die dranginkontinenz, die auch als reizblase bezeichnet wird, bei der man einen ständigen harndrang verspürt obwohl die blase nicht voll ist. urin geht unkontrolliert ab. der grund dafür ist entweder eine überaktivität der blasenmuskeln oder eine übersensibilität der schleimhaut. die belastungsinkontinenz wird durch körperliche anstrengung ausgelöst und urin geht ab, ohne dass vorher harndrang verspürt wurde. in diesem fall ist meist der schließmuskel der blase zu schwach, um den ausgang abzudichten. bei überlaufinkontinenz wird die blase voll, aber die muskeln reagieren nicht. somit geht kontinuierlich unkontrolliert urin tröpfchenweise ab. der betroffene hat zwar die wahrnehmung der vollen blase, kann sie aber nicht willentlich entleeren. schließlich tritt noch die reflexinkontinenz auf, bei welcher sich die blasenmuskeln unwillkürlich zusammenziehen, obwohl vorher kein harndrang zu verspüren war und die blase auch nicht voll ist. je nach art der inkontinenz kann dem betroffenen beispielsweise mit training der beckenbodenmuskulatur, mit medikamenten, mit gezieltem toilettentraining oder auch mit einer operation geholfen werden. blasentumor. es gibt gutartige und bösartige blasentumoren. beide verursachen zunächst ähnliche symptome, wie beispielsweise schmerzen im unterleib und beim wasserlassen, schwierigkeiten harn abzulassen oder eventuell blut im urin. beide arten kommen eher in höherem alter vor. ein gutartigen tumor kann durch eine operation entfernt werden und die funktion der blase ist danach meist wieder hergestellt. ein bösartiger tumor (blasenkarzinom ) bedarf ebenfalls der operation, allerdings sind nach dem eingriff eine strahlen- und/oder chemotherapie nötig. wichtig beim blasenkarzinom ist die früherkennung und die behandlung in einem frühen stadium, damit eine streuung von tochtergeschwülsten (metastasen ) verhindert wird. beschwerden beim wasserlassen (miktionsstörungen). treten beim entleeren der blase beschwerden auf, so kann das je nach art der beschwerden verschiedene ursachen haben. sehr oft liegt eine entzündung der blase oder eine entzündung der harnwege vor. man verspürt schmerzen und brennen beim wasserlassen und hat schwierigkeiten die blase zu entleeren (dysurie). eine weitere störung ist häufiger harndrang (pollakisurie), d.h. man muss oft zur toilette, scheidet aber nur geringe mengen an urin aus. eine erhöhte urinmenge (polyurie ), eine verminderte urinmenge (oligurie) oder eine verschwindend kleine urinausscheidung (anurie ) kann der hinweis auf eine herzerkrankung oder nierenerkrankung sein. eine andere störung ist nächtlicher harndrang (nykturie). der betroffene wacht mehrmals in der nacht durch den blasendruck auf und muss zur toilette gehen. bei diesem symptom ist eine störung der blase möglich, aber auch herzerkrankungen lösen nykturie aus. akuter harnverhalt ist die unfähigkeit harn abzulassen. man verspürt harndrang, kann aber die blase nicht entleeren. eine ursache dafür kann eine infektion sein, entweder der blase oder der prostata. ein weiterer möglicher grund ist die einnahme bestimmter medikamente, die dieses symptom als nebenwirkung auslösen. außerdem kann das abfließen des harns behindert sein, sei es durch blasensteine, einen tumor oder prostatavergrößerung. blasensenkung. die blasensenkung (descensus vesicae) ist eine verlagerung der blase nach unten (richtung beckenboden) und hinten hin. da die männliche harnblase zusätzlichen durch die prostata gestützt wird, kommt es nahezu ausschließlich bei der frau zu dieser störung. die blasensenkung tritt vor allem im fortgeschrittenen lebensalter (ab den wechseljahren ) auf und geht meist einher mit einer veränderten beckenbodenmuskulatur. daneben können auch hormonelle faktoren eine wesentliche rolle spielen. blasensteine. blasensteine sind feste gebilde, die aus mineralsalzen entstehen. diese salze kommen im harn vor, wo sie sich verdichten, absetzen und zu harten klumpen werden. wenn sich die harnsteine direkt in der blase bilden, nennt man sie primäre blasensteine. bilden sie sich in den nieren und wandern dann über den harnleiter in die blase, so spricht man von sekundären blasensteinen. ursache für die bildung von harnsteinen können beispielsweise entzündungen, zu geringe flüssigkeitszufuhr, schlechte ernährung oder ein dauerhafter blasenkatheter sein. blasensteine verursachen oft kolikartige unterleibsschmerzen, sowie schmerzen beim wasserlassen oder auch blut im urin. wenn die steine noch klein sind, ist es möglich, dass sie von alleine durch die harnröhre abgehen. sind sie zu groß, werden sie unter örtlicher betäubung in einer blasenspiegelung mit ultraschall zerkleinert und dann entfernt. manchmal ist auch eine operation unter vollnarkose nötig. reizblase. wenn häufiger harndrang verspürt wird, obwohl die blase nicht voll ist, so spricht man von einer reizblase. diese erkrankung gehört zu den blasenspeicherstörungen. dabei muss der betroffene immer wieder und sehr plötzlich zur toilette, weil er das gefühl einer vollen blase hat. die menge des ausgeschiedenen urins ist aber sehr gering, manchmal sind es nur ein paar tröpfchen. nach dem wasserlassen tritt kein erleichtertes gefühl ein. es gibt körperliche ursachen für die reizblase, wie beispielsweise eine fehlsteuerung des blasenmuskels, eine entzündung oder hormonschwankungen. doch auch psychische belastungen, wie stress oder probleme sind mögliche auslöser einer reizblase. als therapie werden medikamente eingesetzt, aber auch psychotherapie und gezieltes blasentraining kann helfen. übrigens: wenn sie solche informationen interessieren, dann fordern sie unbedingt meinen kostenlosen praxis-newsletter „unabhängig. natürlich. klare kante.“ dazu an:. beitragsbild: pixabay.com – alexas_fotos. dieser beitrag wurde letztmalig am 06.06.2012 aktualisiert.
Inhalt lesen
audio content is empty.