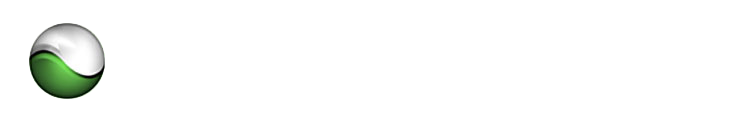ENDOGEN
„Die Zukunft gehört den Informierten, nicht den Angepassten.“
Interessante Entwicklungen, die hier besprochen werden – und ja, viele Tendenzen, die sich abzeichnen, haben auch eine klare Auswirkung auf freie Berufe, wie z. B. die der Ernährungsberater.
Ich beobachte derzeit eine massive digitale Überlagerung von Ernährungsberatung und sogar Ernährungsmedizin. KI-Systeme, App-basierte Programme, Kassenlösungen: Sie geben dem Nutzer sofort Feedback, automatisierte Empfehlungen oder sogar ärztlich anmutende Analysen – und das oft kostenlos oder in Verbindung mit Krankenkassenmodellen.
Dazu kommen „Health Watches“, Apps mit Kalorien- und Nährstofftracking, DNA-basierte Empfehlungen oder Microbiom-Analysen, die mit wenigen Klicks verfügbar sind. Das macht es für klassische Ernährungsberater enorm schwer, sich abzuheben – es sei denn, sie sind Teil eines größeren (meist kassenfinanzierten) Systems oder sehr lokal/praktisch aufgestellt.
Ich sehe dabei ein ähnliches Problem wie in der Naturheilkunde allgemein: Wer nicht extrem spezialisiert ist oder sich nicht durch Fachwissen im biochemischen Detailsegment auszeichnet, wird untergehen oder von Algorithmen ersetzt.
In meinem eigenen E-Book z. B. gehe ich auf genau diese biochemische Individualisierung ein – mit orthomolekularen und zellbiologischen Hintergründen, weit über das hinaus, was ein digitaler „KI-Berater“ derzeit leisten kann. Aber auch da: Die Präsenz muss stark sein, um überhaupt Klienten zu gewinnen. Menschen, die es praktisch, verständlich und nah mögen, sind noch erreichbar – aber der Trend geht ganz klar Richtung Automatisierung.
Das ist für freie Ernährungsberater ein realistisches Risiko – und wer heute nicht up-to-date ist, steht morgen vor dem Nichts.