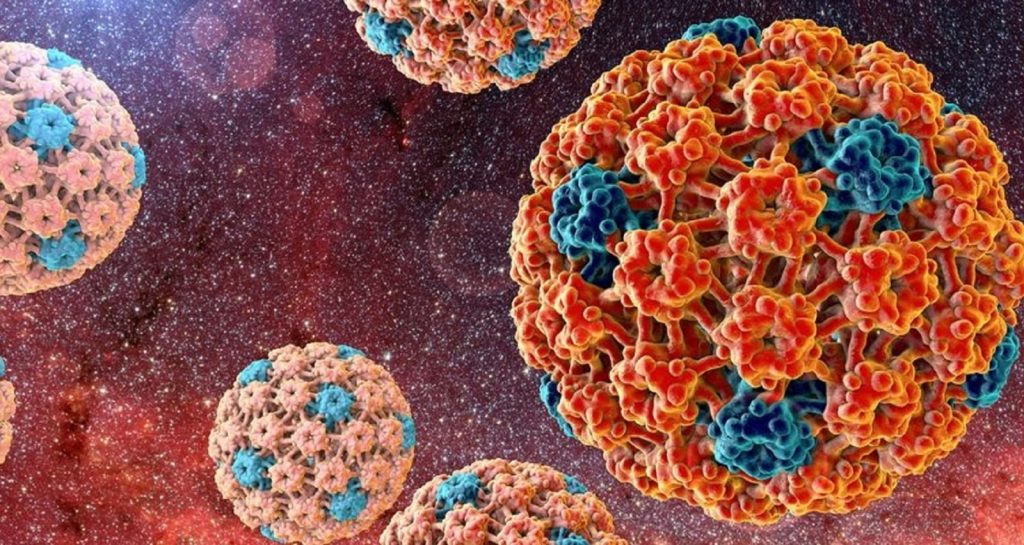
Chemotherapie – eine Therapie, die keine ist?
Chemotherapie ist ein entsetzliches Wort, da es eng assoziiert ist mit der Behandlung von Krebserkrankungen. Und Krebs ist eine Krankheit, die selbst viel Leid mit sich bringt und lebensgefährlich ist.
Aber die Chemotherapie steht der Krankheit, gegen die sie ja eigentlich gerichtet ist, in diesen Punkten kaum nach. Dafür kommt jetzt die knüppeldicke Nachricht, dass die Standardtherapie bei Krebserkrankungen vielleicht gar nicht so wirksam ist, wie man es uns Jahrzehnte lang weismachen wollte.

123rf.com – Yuiy Klochan
Was ist Chemotherapie überhaupt?
Unter Chemotherapie versteht man in der Fachsprache nicht nur die Behandlung von Krebsleiden mit Zytostatika, sondern auch den Einsatz von Antibiotika gegen Infektionen. Hier soll es aber um die Chemotherapie als Krebsbehandlung gehen.
Gefunden hat man die Chemotherapeutika übrigens nicht in der medizinischen Forschung, sondern bei der Suche nach chemischen Waffen. Bei Versuchen mit Senfgas, das im Ersten Weltkrieg als grausame Waffe eingesetzt wurde, stellte man fest, dass es lebende Zellen zerstört. Besonders effektiv ist das Senfgas bei Zellen, die sich schnell teilen.
Dazu gehören Knochenmarkszellen, Darmschleimhautzellen, Zellen des Lymphsystems und eben auch Krebszellen. Tatsächlich sind alle Chemotherapeutika, die heute zur Krebsbehandlung eingesetzt werden, mehr oder weniger eng mit dem Senfgas verwandt. Die Hoffnung ist, dass die Medikamente die Krebszellen schneller vergiften als die übrigen Körperzellen.
Dass das nicht ohne „Flurschaden“ abgeht, ist einleuchtend, wird aber für die Hoffnung auf Hilfe gegen den Krebs oft in Kauf genommen. Doch scheinbar ist diese Hilfe viel kleiner als bisher angenommen, möglicherweise sogar gar nicht vorhanden.
Was ist los?
Die neuesten Forschungsergebnisse lassen verlauten, dass möglicherweise die Chemotherapie nicht der Stein der Weisen bei der Behandlung von Krebserkrankungen ist, da die behandelten Krebszellen sowieso im Begriff sind, abzusterben.
Hierzu gibt es unter anderem eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2011 in der Fachzeitschrift „Science“ vom Dana-Farber Cancer Institut in Boston (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22033517).
Die Forscher fanden heraus, dass Krebszellen, die kurz vor der Apoptose (also dem natürlichen Zelltod) stehen, deutlich besser auf Chemotherapeutika ansprechen als solche, die noch weit von diesem Stadium entfernt sind. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Chemotherapie weniger effektiv beziehungsweise sogar wirkungslos ist, wenn Tumorzellen behandelt werden, die noch weit vom natürlichen Zelltod entfernt sind.
Bestenfalls könnte eine Chemotherapie nur den natürlichen Prozess der Apoptose beschleunigen. Denn die Apoptose ist ein Schutzmechanismus jeder gesunden Zelle gegen Entartungen, die allerdings bei Krebserkrankungen außer Gefecht gesetzt worden ist.
Um zu diesen „kühnen“ Behauptungen zu gelangen, benutzten die Forscher eine Technik, die sie „BH3-Profilierung“ nannten. Denn die Forscher des Dana-Farber Teams hatten zuvor entdeckt, dass es möglich ist, zu messen, wie nahe eine Zelle an dem Schwellenwert ist, der eine Apoptose auslöst.
Diese Technik benutzt Protein-Untereinheiten, die als BH3-Peptide bekannt sind. Sie gehören zu einer Familie von Proteinen, die einen entscheidenden Einfluss auf die Auslösung oder Verhinderung der Apoptose haben. Indem man jetzt Zellstämme mit BH3 in Kontakt gebracht hatte, beobachtete man, wie viel BH3 nötig war, um eine Apoptose auszulösen. Die Zellen, die die geringsten Mengen an BH3 benötigten, waren Zellen, die für die Apoptose schon vorgezeichnet waren.
In der zitierten Studie benutzten die Forscher erstmalig diese Technik bei Myelomzellen von Patienten, die sich auf eine Chemotherapie vorbereiteten.
Ein multiples Myelom, auch als Plasmozytom bekannt, ist eine Krebserkrankung des Knochenmarks, wo vor allem die Plasmazellen betroffen sind. Die Resultate dieser Arbeit zeigten eine starke Korrelation zwischen den Krebszellen, die für die Apoptose besonders vorgezeichnet waren, und denen, die für eine Chemotherapie sehr empfänglich waren.
Die Forscher benutzten dann die Profilierungstechnik, um eine Reihe von anderen Tumorarten zu studieren, die von 85 verschiedenen Patienten stammten. Dies waren multiples Myelom, verschiedene Formen der Leukämie und Eierstockkrebs.
In allen Fällen fanden sie den gleichen Zusammenhang: Die Chemotherapie war dann besonders wirksam, wenn die Tumorzellen kurz vor der Apoptose standen bzw. für diese vorgezeichnet waren.
Und was jetzt?
Wie es aussieht, besteht der dringende Verdacht, dass sich die schulmedizinische Praxis in der Behandlung von Krebserkrankungen einem Umdenkprozess unterziehen muss oder sollte. Denn diese Befunde nagen am konventionellen Verständnis, wie eine Chemotherapie funktioniert.
Die althergebrachte Ansicht ist, dass die Chemotherapie auf schnell wachsende Zellen Einfluss nimmt, wie die Krebszellen zum Beispiel. Aber die neuen Ergebnisse zeigen, dass die Chemotherapie Krebszellen ins Visier nimmt, die sowieso bald absterben werden. Bei nicht vorgezeichneten Krebszellen hat sie möglicherweise keine signifikante Wirksamkeit.
Diese Entdeckung macht es den Therapeuten auch möglich, vorherzusagen, welche Krebspatienten auf eine Chemotherapie ansprechen und welche nicht. Man würde zwar die Chemotherapie optimieren, indem ihr Einsatz die Apoptose schneller herbeiführen kann. Allerdings muss man sich gleichzeitig die Frage stellen, ob es sich hier nur um einen Zeitgewinn handelt oder ob das gesamte Konzept infrage zu stellen ist.
Denn wenn es sich nur um einen Zeitgewinn handelt, dann stellt sich die Frage, ob die damit verbundenen Nebenwirkungen, die nicht selten drastischer Natur sind, diesen minimalen Vorteil rechtfertigen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Wenn der Krebs von alleine verschwindet
Im Moment ist es noch zu früh, um diese Frage definitiv beantworten zu können. Denn immer mehr wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass Krebs auch spontan ausheilen kann.
Es gibt da eine Studie mit 83 Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphom, die nicht behandelt worden waren. Die Forscher der Stanford Universität berichteten, dass 19 (entspricht 23 %) Patienten eine spontane Regression von ihrem Leiden erfuhren (N Engl J Med, 1984; 311: 1471 C5).
Erst neulich beobachteten die Forscher am Norwegian Institute of Public Health in Oslo zwei Gruppen von Frauen, die beide ein vergleichbares Gesundheitsprofil hatten und die ersten Zeichen von Brustkrebs.
Eine Gruppe wurde jedes zweite Jahr per Mammographie beobachtet, von 1996 bis 2001. Die andere Gruppe wurde nur einmal am Ende der Studienzeit untersucht. Nach Ausschluss aller Störfaktoren, wie zum Beispiel die Fälle von duktalem Karzinom in situ (Veränderungen in den Milchgängen der Brust), der als Krebs angesehen wird, obwohl er keiner ist, zeigte sich eine Häufigkeit von Brustkrebs in der ersten, regelmäßig untersuchten Gruppe, die 22 Prozent höher ausfiel als in der Gruppe mit nur einer Abschlussuntersuchung.
Die Forscher schlossen daraus, dass, weil die Inzidenz von Brustkrebs bei nicht regelmäßig untersuchten Frauen nie an die von regelmäßig untersuchten Frauen reichte, einige der Fälle von Brustkrebs in der regelmäßigen Untersuchung gesehen werden, aber nach sechs Jahren verschwunden sind und so von einer Einmaluntersuchung nicht erfasst werden (Arch Intern Med, 2008; 168:2311¨C6).
Wenn man solche Interpretationen ablehnt, dann bliebe als einzige Möglichkeit der Erklärung, dass die Mammographie selbst zu einer Erhöhung der Inzidenz beiträgt. Aber das ist ein anderes Thema.
Eine andere Studie vermutet, dass das Neuroblastom, eine häufigere Krebsform bei Kindern, die die Nebennieren befällt, ebenfalls spontan ausheilen kann. Ärzte im Saitama Kinderkrankenhaus in Iwatsuki, Japan, warteten und beobachteten elf sechs-Monate-alte Babys mit Neuroblastom im Stadium 1 und 2, dem Frühstadium, und Tumoren mit einem Durchmesser von weniger als 5 cm.
Nach sechs Monaten passiver Beobachtung hatten sich alle Tumore verkleinert, obwohl in keinem Fall der Tumor vollkommen verschwunden war. Aufgrund dieser Beobachtung resümierten die Forscher, dass spontane Regressionen nicht so selten sind wie angenommen (J Clin Oncol, 1998; 16:1265¨C9).
Und dies sind nur einige wenige Beispiele für spontane Regressionen von Krebserkrankungen in der medizinischen Literatur. Bislang weiß niemand, wie diese zustande kommen. Aber das Phänomen wurde im Zusammenhang gesehen mit fiebererzeugenden Infektionen, wie sie von Viren, Pilzen und Bakterien verursacht werden (Indian J Cancer, 2011; 48: 246¨C51).
Dies zeigt zwar, dass der menschliche Organismus in der Lage ist, bis zu einem gewissen Grad Krebserkrankungen selbst zu bekämpfen, aber niemand weiß, wie oft dies passiert. Ein Grund für dieses Unwissen ist auch die Tatsache, dass ein einmal entdeckter Krebs sofort therapiert wird.
Die Häufigkeit von spontanen Regressionen wird allgemein auf 1:60.000 geschätzt. Es gibt aber Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass die realistischeren Zahlen sich in einem Bereich von 20 bis sogar 100 Mal häufiger bewegen. Das wäre also 1:3000 bis 1:600 (O’Regan B, Hirshberg C. Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography. Petaluma, CA: Institute of Noetic Sciences, 1993).
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Statistische Tricks
Es ist verständlich, dass Ärzte den Patienten Hoffnungen machen, damit sie nicht aufgeben. Freilich muss man dabei auch bei der vollen Wahrheit bleiben. Dazu gehören auch die Berichte über Fortschritte in der Chemotherapie. Richtwert dafür ist die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Sterblichkeitsquote. Dazu schauen sich Forscher an, wie viele Patienten nach 5 oder 10 Jahren noch leben.
Stichtag der „Stoppuhr“ ist der Zeitpunkt, an dem die Diagnose erstellt wurde. Und das geschieht immer früher. Dann haben die Kranken natürlich auch noch länger zu leben. In Studien wird diese längere Lebenserwartung einfach der Chemotherapie als Erfolg zugeschrieben. Der kritische Arzt und „Nestbeschmutzer“ Dr. Peter C. Gøtzsche erklärt dies am Beispiel der Brustkrebsforschung. Von 1996 bis 2016 ist laut Studien die 5-Jahres-Überlebensrate von Frauen mit Brust-Tumor von 12 % auf 18 % gestiegen.
Während dieser 20 Jahre ist die Häufigkeit der Mammographien in die Höhe geschnellt. Dies hatte zur Folge, dass die Erkrankung immer früher festgestellt wird und dann haben die Patientinnen – ob mit oder ohne Chemotherapie – auch noch länger zu leben. An der medikamentösen Behandlung liegt das allerdings nicht!
Noch ein anderer Punkt verfälscht die Statistik, die bei flüchtigem Hinsehen recht optimistisch aussieht: Mit dem massenhaft angewandten Brustkrebs-Screening werden auch Tumore gefunden, die nie zu einem größeren Problem geworden wären.
Auch diese Fälle gehen in die Zählung ein und verbessern das Gesamtbild. Beim Hautkrebs-Screening sieht es ähnlich aus. Viel mehr Menschen als früher lassen sich beim Hautarzt checken. Deswegen werden heute mehr Tumore entdeckt, von denen viele niemals zum Tod geführt hätten. In der Statistik täuscht dies eine höhere Überlebensrate vor.
In Wirklichkeit allerdings sind die Heilungs-Chancen in gravierenden Fällen über die Jahrzehnte hinweg praktisch gleich geblieben (Gøtzsche PC. Survival in an overmedicated world: look up the evidence yourself. Copenhagen: People’s Press; 2019).
Auch die Behandlung mit mehr als einem Chemotherapeutikum wird in der Schulmedizin als Fortschritt gefeiert. Diese „Polychemotherapie“ entlarvte Gøtzsche ebenfalls als Papiertiger. Der dänische Arzt schaute sich einmal diese Studie dazu genauer an: „Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials.“ (Lancet. 2005 May 14-20;365(9472):1687-717).
In der Arbeit behaupten die Autoren, bei Brustkrebs sei die kombinierte Medikation der Gabe eines einzelnen Medikamentes enorm überlegen. Gøtzsche suchte nun nach den Daten, aus denen diese Annahme zweifelsfrei hervorgeht. Doch diese Tabellen und Diagramme waren in der Studie gar nicht enthalten.
Der Däne musste Detektiv-Arbeit leisten, um die Zaheln mit eigenen Augen sehen zu können. Und die sehen so aus: Die 15-Jahres-Sterblichkeitrate ist unter einer Polychemotherapie nur um 3 % niedriger als unter Einzel-Präparate.
Dieser geringfügige Unterschied war die Grundlage des gespielten Freudentanzes. Und der verschwindend kleine Vorteil war sicher auch der Grund für die Geheimnisikrämerei der Autoren.
Die Chemotherapie zum zweiten
Wenn man sich die Dana-Farber-Arbeit unter diesen Aspekten anschaut, dann könnte man auf den dummen Gedanken kommen, dass die Schulmedizin sich hier mal wieder mit fremden Federn schmückt.
Man wartet auf den Zeitpunkt, an dem die Krebszellen von selbst absterben, schreitet kurz zuvor als Retter und Erlöser ein und behauptet, man selbst hätte die üble Krankheit in die Knie gezwungen. Das hört sich doch nach einem bekannten Taschenspielertrick an. Oder soll ich sagen: Quacksalberei? Ich weiß, das ist Provokation pur. Aber nicht ich habe diese Fragen aufgeworfen.
Dieses Thema kommt vom Dana-Farber-Institut, das nicht unbedingt an Unbekanntheit leidet. Der Fairness halber muss man aber zugestehen, dass man nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass nicht doch Zellen von der Chemotherapie in den Tod getrieben werden beziehungsweise ohne diese überleben würden. Bei dieser Frage steht die Wissenschaft noch am Anfang.
Es wird aber auch in einem so frühen Stadium der Erkenntnis und mit noch so großen Wissenslücken schon sehr deutlich, dass die Chemotherapie bei einer signifikanten Anzahl von Patienten schlicht und ergreifend unwirksam ist. Diese Patienten dann mit diesen Medikamenten zu traktieren, macht nicht nur keinen Sinn, es ist auch vom ethischen Standpunkt nicht zu vertreten.
Oder ist der Eid des Hippopotamus nur Makulatur? Immerhin bietet sich jetzt die Chance, eine individualisierte Therapie einzuleiten und Nebenwirkungen von denen fernzuhalten, die für eine Chemotherapie nicht infrage kommen.
Die X-Files der Schulmedizin
Die Chemotherapie: Geringe Wirkung bei hohen Risiken
Der Krebsspezialist Dr. Ulrich Abel führte eine Metaanalyse von Studien durch, in der er die Heilungserfolge der Chemotherapie bei fortgeschrittenem Krebs untersuchte. Er kam zu dem Schluss, dass, von Lungenkrebs und Eierstockkrebs abgesehen, es keinen direkten Beweis gibt, dass die Chemotherapie in der Lage wäre, die Überlebensrate der Betroffenen zu verlängern (Biomed Pharmacother, 1992; 46: 439¨C52).
Aber die Schlussfolgerung liegt jetzt bereits 20 Jahre zurück. Unlängst bewerteten australische Forscher den Nutzen der Chemotherapie bei der Behandlung von häufigen Krebsformen. Sie konnten zeigen, dass der Beitrag der Chemotherapie für eine verlängerte Überlebenszeit nur schlappe 2 Prozent ausmacht. Nur 13 von 22 Krebsformen zeigten Verbesserungen der 5-Jahresüberlebensrate. Die Verbesserung von mehr als 10 Prozent war nur bei 3 der 13 Krebsformen gegeben.
“Despite the early claims of chemotherapy as the panacea for curing all cancers, the impact of cytotoxic chemotherapy is limited to small subgroups of patients and mostly occurs in the less common malignancies,” the researchers concluded (Clin Oncol [R Coll
Radiol], 2004; 16: 549¨C60).
Übersetzt: Trotz der früheren Behauptungen, dass die Chemotherapie als das Allheilmittel gegen alle Formen von Krebserkrankungen anzusehen ist, bleibt die durchschlagende Wirksamkeit einer zytotoxischen Chemotherapie begrenzt auf kleine Untergruppen von Patienten und kann nur bei weniger häufigen Krebsformen beobachtet werden.
Diese Befunde widersprechen allerdings der Auffassung vieler Patienten, die glauben, dass sie eine Behandlung bekommen, die signifikant ihre Lebenserwartung und die Chance auf eine Heilung erhöht. Bei einer besseren Orientierung über diesen Sachverhalt würden mit Sicherheit eine ganze Reihe von ihnen es sich noch einmal überlegen, ob sie einer solchen Therapie den Zuschlag geben würden, die einen schweren Einschnitt in ihre Lebensqualität haben wird.
Nebenwirkungen sind nicht nur der bekannte Verlust von Haaren und die Übelkeit. Auch Infektanfälligkeit, geschädigte Eizellen und Spermien und viele andere, medikamentenabhängige Nebenwirkungen sind häufig. Verheerendere Nebenwirkungen, die vielleicht nicht so bekannt, aber auch nicht selten sind, sind Schmerzen oder toxische Effekte im Gehirn, die zu Desorientierung, Gedächtnisverlust und Sprechproblemen führen.
Zu genau diesem Thema gibt es nun auch eine interessante Studie, die das schon seit geraumer Zeit beobachtete Phänomen des „Chemo-Hirns“ oder „Chemo-Nebels“ beschreibt. In dieser Arbeit zeigten die Autoren, dass die Auswirkungen der Chemotherapeutika auf das Gehirn so tiefgreifend sein können, dass die behandelten Patienten eine Reihe von Störungen aufweisen:
Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit, Probleme mit Multi-Tasking- Aufgaben, mit der räumlichen Orientierung (deutlich häufigeres Verlaufen), mit der Wahl der Worte usw. Obwohl die Autoren festhalten mussten, dass nicht alle Patienten gleich stark von diesen Phänomenen betroffen waren, kann niemand niemandem garantieren, dass er zu der nebenwirkungsfreien Gruppe im Falle einer Chemotherapie gehören wird.
Aber nicht nur das gehört zu den üblen Folgen einer solchen Therapie. Es kann sogar noch schlimmer kommen: Auch der vorzeitige Tod ist eine dieser Nebenwirkungen (JAMA, 2008; 299: 2494;Acta Oncol, 2011 Aug 18). Und: Wer eine Chemotherapie überstanden und den dazugehörigen Krebs überlebt hat, läuft Gefahr, später einen noch aggressiveren Krebs zu bekommen.
Übrigens: Wenn Sie so etwas interessiert, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Newsletter
„Hoffnung bei Krebs“ dazu an:
Beitragsbild: 123rf.com – Kateryna Kon




