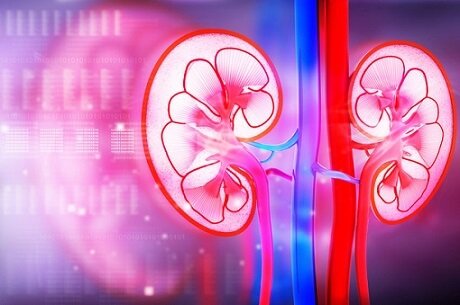Dialyse – Was ist das und was bedeutet das für Betroffene?
Unser Körper produziert jeden Tag giftige Stoffwechselprodukte wie Harnstoff, Harnsäure oder Kreatinin. Normalerweise werden diese mithilfe der Nieren, die wie ein effektiver Filter fungieren, mit dem Harn ausgeschieden. Wenn die Selbstreinigung des Körpers gestört ist, muss mithilfe der Dialyse regelmäßig eine künstliche Blutwäsche vorgenommen werden.
Als häufige Ursache für eine lebensbedrohliche Anreicherung von Giftstoffen im Blut ist die (akute oder chronische) Niereninsuffizienz zu nennen. Zurzeit gibt es allein in Deutschland mehr als 70.000 Dialysepatienten. Zum ersten Mal wurde das Verfahren im Jahre 1924 in Gießen eingesetzt. Auch bei eigentlich gesunden Menschen wird die Dialyse im Rahmen der Hämoperfusion zuweilen bei einer Vergiftung angewandt. In diesem Fall wird das Blut durch Aktivkohlebehälter geleitet, in denen die Giftstoffe adsorbiert werden. Zu unterscheiden sind grundsätzlich diese drei Dialyseverfahren:
- die Hämofiltration
- die Peritonealdialyse (via Bauchfell)
- die Hämodialyse
Bei allen Varianten wird dem Körper kontinuierlich Blut entnommen, um es mithilfe einer Membrane (Dialysator) zu filtern. Damit die Giftstoffe noch effizienter ausgewaschen werden, wird gegebenenfalls eine Spülflüssigkeit (Dialysat) eingesetzt. Nach der Reinigung des Blutes wird dieses dem Körper wieder zugeführt. In diesen Fällen ist eine akute Dialyse dringend erforderlich:
- Bei einem akuten Nierenversagen steigen infolge einer Überwässerung (Hypervolämie) die Kaliumwerte deutlich an. Als Ursache kommt ein Lungenödem oder eine Herzinsuffizienz infrage.
- Im Falle einer Vergiftung beispielsweise mit Methanol oder dem Antidepressivum Lithium wird eine Urämie vorrangig durch harnpflichtige Substanzen verursacht.
Bei einer bereits chronisch fortgeschrittenen Niereninsuffizienz braucht es entsprechend eine chronische Dialyse. Bei dieser Langzeitdialyse sprechen wir über eine meistens lebenslange Behandlung, die zum Beispiel jeden zweiten Tag zu erfolgen hat.
Ankündigen tut sich die Verschlechterung der Nierenfunktion unter anderem mit diesen Symptomen:
- Deutliche Erhöhung des Blutdrucks
- Veränderung des pH-Wertes des Bluts
- Massive Verschiebungen in der Zusammensetzung der Elektrolyte (Blutsalze)
- Der GFR-Wert sinkt unter 15 Millimeter pro Minute. (Die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) ist ein Maßstab für die Nierenfunktion.)
Wie stellt sich die Dialyse für den Patienten dar?
In hoher zeitlicher Rate wird dem Körper Blut entnommen und quasi gleichzeitig wieder zugeführt. Das Problem dabei ist, dass die Arterien nicht gut zugänglich sind und in den Venen der Blutdruck zu gering ist, sodass diese sich als Zugang für die Dialyse eher schlecht eignen. Daher wird für die langfristige Dialyse operativ ein Gefäßzugang angelegt, der als Dialyse-Shunt bezeichnet wird.
Bei dem sogenannten AV-Shunt handelt es sich um eine künstliche Verbindung zwischen einer Arterie und einer Vene. Meistens wird dazu ein kleiner Plastikschlauch (Interponat) zum Beispiel im linken Unterarm eingesetzt. Das Interponat kann für die Dialyse jedes Mal problemlos mit einer Nadel angestochen werden. Für eine akute Dialyse wird dagegen eine relativ große Kanüle als Shaldon-Katheter in eine große Vene in der Leiste, am Schlüsselbein oder am Hals verwendet.
Was bedeutet Antikoagulation in diesem Zusammenhang?
Im Zuge einer Dialyse kommt das Blut mit mehreren Teilen der Dialysemaschine in Kontakt. Da solche Teile aus Kunststoff gefertigt sind, aktivieren sie die Blutgerinnung. Man spricht deshalb auch von thrombogenem Material. Aus diesem Grunde muss die Blutgerinnung während der Dialysebehandlung zum Beispiel mit Heparin gehemmt werden.
Bei der regionalen Antikoagulation führt man der Dialysemaschine etwas Citrat zu. Es bindet dann das im Blut befindliche Calcium, das für den Gerinnungsprozess verantwortlich ist. Am Ende der Blutwäsche wird dem Blut wieder Calcium zugemischt.
Sowohl die Hämodialyse als auch die Hämofiltration werden in aller Regel in einem Krankenhaus oder in einer dafür ausgestatteten Arztpraxis durchgeführt. Langzeitdialyse bedeutet, dass der Patient die bis zu fünfstündige Blutwäsche dreimal pro Woche via Shunt über sich ergehen lassen muss. Die Peritonealdialyse lässt sich im Rahmen der Heimdialyse zum Beispiel während der Nacht zu Hause durchführen, was die meisten Patienten als sehr vorteilhaft empfinden.
Wichtige Hinweise für Dialyse-Patienten
Jeder kann dafür sorgen, dass der Anteil der harnpflichtigen Substanzen über die Ernährung minimiert wird. Da dem Körper durch Dialyse wichtige Stoffe entzogen werden, kann es zu einem deutlichen Gewichtsverlust kommen. Dem kann zum Beispiel eine kompetente Diätassistenz entgegenwirken.
Urlaub ist heute für den Dialyse-Patienten im Prinzip problemlos möglich. Innerhalb von Deutschland lässt sich sogar kurzfristig eine nahe gelegene Adresse für die Hämodialyse finden. Im Falle des Auslandsurlaubs sollte unbedingt zusätzliche Zeit für die Organisation der Dialyse eingeplant werden. Wer gerade erst mit der Dialyse begonnen hat, sollte seinem Körper genügend Zeit einräumen, um sich an die Prozedur zu gewöhnen, und erst danach einen Urlaub in Erwägung ziehen. In diesem Zusammenhang sei auf die Möglichkeit der Dialyse-Kreuzfahrt hingewiesen, siehe dazu auch:
Spezialisierte Reisebüros, Selbsthilfegruppen oder Anzeigen in Fachzeitschriften beziehungsweise Dialyse-Führer geben regelmäßig aktualisierte weltweite Adresslisten für Ferien-Dialysen für Hämodialyse-Patienten aus. Für Kassenpatienten ist es auf jeden Fall ratsam, den Modus der Kostenübernahme für die Dialyse im Ausland mit der Krankenkasse vor Reiseantritt zu klären.
Ihr behandelnder Arzt stellt im Vorfeld der Reise die relevanten Daten wie die Dialysedauer, das Trockengewicht, die Laborwerte und die erforderlichen Medikamente für die Gast-Dialyse zusammen. Diese Informationen sollten Sie schon vor Reiseantritt an die Gast-Dialysepraxis senden und mit dieser abklären, welche Medikamente Sie unbedingt selbst mitbringen müssen. Es gibt Organisationen für Dialyse-Patienten, die gegebenenfalls behilflich sind, eine notwendige Rückholaktion zu organisieren.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Dialyse-Risiken
Dem recht häufigen Blutdruckabfall kann mit einer Senkung der Filtrationsrate, die nicht höher als 600 ml Blut pro Stunde betragen sollte, entgegengewirkt werden. Ebenfalls hilfreich ist eine Absenkung der Temperatur des Bluts.
Ausgelöst durch die Blutdrucksenkung kann es zu Übelkeit und Erbrechen insbesondere bei einer sehr lang andauernden Dialyse kommen. Dagegen haben sich MCP-haltige Mittel bewährt.
Durch den Entzug von Mineralien während der Dialyse können Muskelkrämpfe eintreten, die sich aber mittels Massage gut behandeln lassen. Das Beruhigungsmittel Diazepam wirkt ebenfalls muskelentspannend.
Bei Kopfschmerzen hilft zum Beispiel Paracetamol. Darüber hinaus können noch diese Nebenwirkungen auftreten:
- Juckreiz
- Fieber
- Schüttelfrost
- Brust- oder Rückenschmerzen
- Herzrhythmusstörungen
- Dysäquilibriumssyndrom
Letzteres kommt nur selten vor und ist mit Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen und/oder epileptischen Anfällen verbunden. Durch eine Einspeisung von Flüssigkeit aus Gefäßen ins Gewebe kann dieses anschwellen und im schlimmsten Fall ein Hirnödem auslösen, das lebensgefährlich ist.
Mit folgenden Komplikationen ist allein beim Gefäßzugang (AV-Shunt) zu rechnen:
- Infektion im Bereich des Shunts
- Wandaufweitung (Aneurysma)
- Verminderung der Durchblutung des Gewebes hinter dem Shunt
- Gefäßverschluss
Geringere Lebenserwartung
Bei allem medizinischen Fortschritt sollten wir uns nichts vormachen. Eine so schwere Grunderkrankung wie eine Niereninsuffizienz birgt ein hohes Risiko für Begleit- und Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus, Herzinfarkt oder Schlaganfall, sodass der Dialyse-Patient von einer verminderten Lebenserwartung ausgehen muss.
Zusammenfassende Übersicht
In der Laborchemie ist Dialyse ein Sammelbegriff für verschiedene Trenn- und Reinigungsverfahren. In der Medizin geht es vielmehr um blutreinigende Therapiemethoden zur Entfernung von Toxinen und harnpflichtigen Substanzen im Sinne eines Nierenersatzverfahrens. Dabei sind diese unterschiedlichen Formen zu unterscheiden:
- Hämodialyse
- Hämofiltration
- Hämodiafiltration
- Hämoperfusion (im Falle einer akuten Vergiftung)
- Peritonealdialyse (über das Bauchfell)
Die Notwendigkeit einer akuten Dialyse ergibt sich unter anderem aus:
- Akutes Nierenversagen zum Beispiel aufgrund einer Operation, eines Unfalls oder Traumas
- Hyperkaliämie
- Metabolische Azidose
- Lungenödem mit Atemnot bei Überwässerung
- Urämische Enzephalopathie oder Serositis wie Perikarditis
- Vergiftungen, sofern die Toxine überhaupt dialysierbar sind (Lithium, Acetylsalicylsäure)
Die chronische Dialyse erfolgt aufgrund:
- eines symptomatischen Nierenversagens
- einer zu niedrigen glomerulären Filtrationsrate (GFR < 15 ml/min/1,73m²)
- einer Urämie (Harnstoff-N > 100 mg/dl) oder einer therapierefraktären Hyperphosphatämie
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2022 erstellt.